Das kritische Potential der Ausnahme für die Post-COVID-19-Normalität
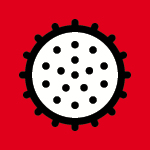
COVID-19 stellt unser soziales, politisches und wirtschaftliches Leben auf den Kopf. Zumindest zwischenzeitlich. So nötig und nachvollziehbar die vom Bundesrat verordneten Einschränkungen sind, so erstaunlich ist die weitgehend unkritische Diskussion der Restriktionen. Laufen wir damit Gefahr, dass sich die Einschränkungen in der Post-COVID-19-Ära zur Normalität mausern?
Aus Spitälern geklautes Desinfektionsmittel, rassistische Anwandlungen gegenüber Chines*innen und leergekaufte Regale: In den anekdotischen Auswüchsen des durch COVID-19 verursachten Ausnahmezustandes manifestiert sich, was Giorgio Agamben als nacktes Leben betitelt. Darin kämpft der auf seine biologische Funktion reduzierte Mensch abseits jeglicher politischen oder sozialen Dimensionen um sein Überleben. So sieht es zumindest der Philosoph selbst. Nach seiner Lesart ermöglicht der Ausnahmezustand den Regierungen die Einschränkung der Freiheiten. Und zwar unumkehrbar und über die Ausnahme hinaus in die Normalität hinein. Befürchtet Agamben zu Recht, dass der Staat den COVID-19-Ausnahmezustand zur nachhaltigen Einschränkung der Freiheiten missbraucht?
Die Reduktion der Politik auf den Bundesrat
Dass mit COVID-19 Massnahmen einhergehen, die tief in die Freiheitsrechte eingreifen, ist augenscheinlich. Der Bundesrat verfügt über die dazu erforderlichen Kompetenzen, womit das Regieren mittels Notrecht in der aktuellen Krise gleichermassen notwendig und rechtlich legitimiert ist. Gleichwohl bedarf es eines Korrektivs oder zumindest einer kritischen Betrachtung, um sicherzustellen, dass mittels Notrechts verordnete Massnahmen nicht den neuen Standard der Rechtsordnung setzen.
Dieses Korrektiv blieb anfänglich weitgehend aus. Kritik erfolgte vorab in Form von Forderungen nach zusätzlichen Restriktionen: #AusgangssperreJetzt #LockdownNow. Unisono erinnerten sich die Parteien der Inschrift in der Bundeshauskuppel und stellten sich nach dem Grundsatz «Eine*r für alle, alle für eine*n» hinter die Massnahmen des Bundesrates. Mitten in der Frühjahrssession verabschiedete sich das Parlament ins Home Office und setzte seine Plenumsarbeit bis zur Sondersession im Mai aus, obschon es auch zum Erlass von Notverordnungen befähigt wäre. Damit fehlt den Schweizer*innen während des aktuellen Ausnahmezustandes das mittelbare Instrument, um auf den bundesrätlich vorgegebenen Lösungsansatz für den Umgang mit COVID-19 zuzugreifen. Oder, um es frei nach Agamben auszudrücken: Die Schweizer*innen müssen den Verlust ihrer politischen Existenz hinnehmen.
Die Ausnahme von der Freiheit
Die Einschränkung unserer Freiheiten kommt mannigfaltig daher. Angesichts der eindringlichen Aufforderung zu Hause zu bleiben, verkommt die Bewegungsfreiheit zur Farce. Besuche der Familie und von Freund*innen gestalten sich als Spiessrutenlauf, den man als potentieller Virenherd absolviert und der rasch in die gesellschaftliche Ächtung führt. Hinzu tritt das Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen. Schulen, Universitäten, Museen und Restaurants sind geschlossen, womit Orte des öffentlichen Austausches zwischenzeitlich wegfallen. Wiederum leidet darunter der politische und soziale Gestaltungsraum der Bevölkerung.
Dass Kritik an diesen teils umfassenden Einschränkungen anfänglich ausblieb, erstaunt aus einer Bürger*innenrechtsperspektive. Nachvollziehbar ist es dennoch. Nicht nur der Bundesrat, sondern auch ein Grossteil der Bevölkerung nimmt die Verbreitung von COVID-19 zu Recht als Notsituation wahr. Entsprechend wird gutgeheissen, dass sich der Bundesrat zwecks eines effizienten Krisenmanagements auf seine Notverordnungskompetenz beruft. Zumal er ausführlich darlegt, weshalb die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung legitim sind und er die Parteichef*innen und Kantonsvertreter*innen ins Boot holt.
Die Ausnahme als Einfallstor für ein «Normalitäts-Tuning»?
Sind Abstriche bei den Freiheitsrechten also hinzunehmen? Kurzfristig und im Falle einer «ausserordentlichen Lage», wie wir sie momentan durchleben, lässt sich dies bejahen. Die Notverordnungskompetenz des Bundesrates beschreibt nicht die endgültige Abkehr von unseren Freiheiten, sondern die einer Notsituation geschuldete Pflicht, die Gesellschaft vor den Folgen des Virus zu schützen. Agambens Befürchtung beschränkt sich indes nicht nur auf die unmittelbare Bewältigung des Ausnahmezustandes. Kritisch wird es, wenn die in der Ausnahme erlassenen Massnahmen die Ausnahme überdauern.
Dass der Bundesrat wie nach dem Zweiten Weltkrieg sieben Jahre und zwei Volksabstimmungen brauchen wird, um das Regieren per Notrecht einzustellen, ist unwahrscheinlich. Umso mehr, weil er sich heute innerhalb der Verfassung bewegt und an diese gebunden ist. Das von Agamben vorgebrachte Argument, wonach der Ausnahmezustand die Überführung von notverordneten Massnahmen in den Normalzustand begünstigt, behält im Kern jedoch seine Gültigkeit. So sah sich der Bundesrat durch COVID-19 etwa veranlasst, per Verordnung die geltenden Bestimmungen zu Pausen und Ruhezeiten des Pflegepersonals auszuhebeln. Nach der Sistierung des Arbeitsgesetzes für diesen Bereich wird die in regulären Notsituationen vorgesehene 60-Stunden-Woche gegen oben geöffnet. Die Verdrängung einer Notsituation durch eine neue Notsituation entbehrt nicht einer gewissen Absurdität. Obschon die Sistierung zeitlich beschränkt ist, kann sie unter Umständen den Boden für die Aufweichung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen in der Post-COVID-19-Ära bereiten und der bereits zuvor geforderten «Teilflexibilisierung» des Arbeitsgesetzes Vorschub leisten.
Der Imperativ des Vorübergehenden
Dem Bundesrat vorzuwerfen, den aktuellen Ausnahmezustand missbräuchlich zur Einschränkung von Freiheitsrechten auszunutzen, greift zu kurz. Erstens weil er trotz Notverordnungskompetenz an die Verfassung gebunden ist. Und zweitens, weil der Bundesrat keine orbanschen Machtansprüche hegt. Die durch den Bundesrat ergriffenen Massnahmen sind nötig und angemessen. Diese unter Berufung auf ideologische Überlegungen zu «boykottieren oder desavouieren» wäre deshalb fehl am Platz. Dennoch sollte die Gesellschaft rechtliche Einschränkungen nicht unkritisch hinnehmen und darauf bestehen, dass das Ausserordentliche nur vorübergehender Natur bleibt. Heute hinzuschauen ist notwendig, um die Rechtseinschränkungen wahrzunehmen, ihnen das Etikett der Ausnahme anzuhängen und sie nach COVID-19 wieder auszusortieren.
Livia Tomás ist Doktorandin am Soziologischen Institut der Universität Neuchâtel. Sie befasst sich im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts mit Migrations- und Mobilitätsplänen von Rentner*innen (Transnational Ageing and Post-Retirement Mobilities). Talin Marino absolvierte den Master in «European Global Studies» am Europainstitut der Universität Basel und befasste sich aus rechtlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive mit Europas globaler Vernetzung.
References:
– Agamben, Giorgio (2016). Homo Sacer: Die souveräne Macht und das nackte Leben. [Original: Homo Sacer: Il potere soverano e la nuda vida (1995)]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
– Agamben, Giorgio (2004). Ausnahmezustand. [Original: Stato di eccezione (2003)]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.


